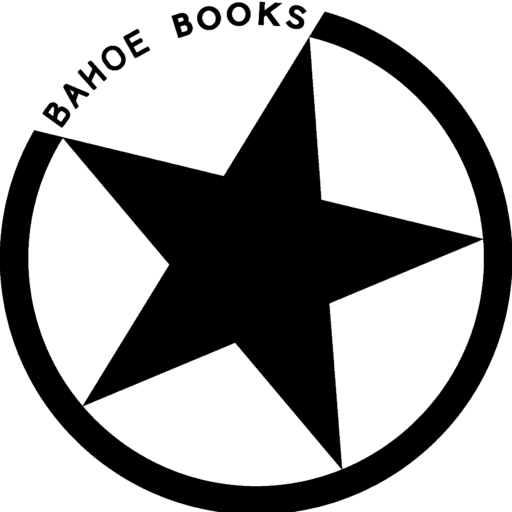In die Debatte über eine moralische Haltung zum Krieg in der Ukraine bringt Marlene Streeruwitz eine weitere Facette ein.
Wir werden alle in diesen Missbrauch durch den Krieg mit hineingezogen. Und deshalb. Helfen ist nicht genug. In der Perversion all unserer Versuche, das Richtige zu tun und moralisch gesellschaftlich zu handeln und damit wenigstens die Kriegsfolgen zu mildern. In dieser Perversion des Kriegs zählen alle unsere kleinen Bemühungen des Helfens dann eben auch zur Beute der Kriegführenden. Auf allen Seiten. Das ist die äußerste Form der Erpressung der Wohlmeinenden durch die Gewalttätigen.
Marlene Streeruwitz
Der Krieg in der Ukraine ist in vielerlei Hinsicht in Europa angekommen, hat sich eingeschrieben in das kollektive wie persönliche Leben. Wir alle sind in den – wie Streeruwitz es beschreibt – Missbrauch der Gewalttätigen hineingezogen, ob wir wollen oder nicht. Dem Krieg, diesem Krieg kann sich niemand entziehen. Von den Bildern des Grauens und der Verwüstung, die uns Medien täglich in unsere Wohnzimmer liefern, über weiter steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten bis hin zur blanken Angst, die Gewalt könnte eskalieren, sich noch weiter ausbreiten.
Die Frage, wie die Wertegemeinschaft Europa sich nun verhalte solle angesichts dieses militärischen Übergriffes, hat zudem eine hitzige intellektuelle Debatte ausgelöst – besonders in Deutschland. Verknappt gesagt geht es um die Frage, wie man sich den Menschen in der Ukraine gegenüber am moralischsten verhält. Praktisch geht es um Waffenlieferungen und um die Entscheidung über das geringere Übel: Soll sich die Ukraine weiter verteidigen – und damit stellvertretend für mindestens ganz Europa den Fortbestand der freien, demokratischen Welt. Oder böte eine militärische (Teil-)Kapitulation der Ukraine nicht eine wesentlich humanere Lösung. Dabei steht der Blutzoll im Kampf gegen einen skrupellosen Aggressor auf der einen Seite, auf der anderen eine formale Niederlage, die jedoch unmittelbar das Leben vieler Menschen retten würde.
Krieg ist das stabilste Modell, wie Geschichte gemacht wurde. (Marlene Streeruwitz)
Krieg ist das Gegenteil von Ethos. Diesen Satz stellt die österreichische Schriftstellerin Marlene Streeruwitz mitten in diese Debatte und verurteilt sie damit zum Scheitern. In ihrem essayistischen “Handbuch gegen den Krieg”, das diese Woche bei bahoe books erscheint, schlägt sich Streeruwitz nicht auf eine der argumentierenden Seiten, sondern nimmt eine klare dritte Position ein: gegen das Konzept Krieg an sich.
Jedes Sich-Einlassen auf eine Logik des Krieges, so ihre Analyse, bedeutet nämlich, selbst in diesen Krieg hineingezogen zu werden, Teil des Taktierens, des Abwiegens von menschlichem Leid und Leben und damit Teil der Logik der Gewalt zu werden. Streeruwitz unternimmt in ihrem “Handbuch gegen den Krieg” den Versuch, diesen Mechanismen zu entkommen, indem sie dieses akribisch analysiert und das Grundübel dahinter zu lokalisieren sucht.
In knappen Definitionen, die als Aphorismen allesamt auch für sich stehen könnten, beleuchtet sie die tiefen wie feinen Netze, mit denen Krieg in Gesellschaften hineinreicht, ja sie sogar bedingt: Zwar zeichnet sie Krieg als das Gegenteil von Zivilisation, als die Institution des Rassistischen, als Produktionsmittel, als einen Handel mit Leben und Tod; sie beleuchtet aber Krieg auch als unsere prägende kulturelle Gründungsgeschichte, als künstliche kollektive Psychose, als Bühne der Mächtigen, als grausame Unterhaltung, als vermeintlich letztes Abenteuer.
Sprachlich sind diese Kurzanalysen trotz der kraftvollen Sprachbilder nüchtern, sie zeigen vernichtend knapp fatale Zusammenhänge auf. Die Kritik an einer Welt, die nach diesen Mechanismen, ja nach der unerbittlichen Logik des Krieges funktioniert, schwingt anfangs zwischen den Zeilen mit und entpuppt sich letztlich als offene wie fundamentale Gesellschaftskritik: Die Gewalt, die Krieg befeuert, so Streeruwitz hat ihre Wurzeln im Alltäglichen, im Rassismus am Arbeitsplatz, in häuslicher Gewalt, sprachlichem Sexismus. Wer gegen den Krieg aufstehen will, muss mit Streeruwitz weitergedacht, die Strukturen des patriarchalen Kapitalismus sprengen, das pflegende, umsorgende, nährende Moment in Gesellschaften dafür aufwerten und besser entlohnen. Der Krieg als Vater aller Dinge hat ausgedient in diesem Weltenwurf, hier hat die Mutter das fürsorgliche Sagen.
Was es dafür braucht, ist ein neues Sprechen über den Frieden: Sprache sprechen muss Friedlichkeit bedeuten, soll die Welt bestehen bleiben. Von Friedlichkeit im Sprechen wissen wir nicht viel. Wir können uns nur in einem langwierigen und schmerzhaften Vorgang des Trauerns von der Grammatik des Kriegs lösen und uns einem Sprechen der Lebenszugewandtheit und damit der Demokratie zuwenden. Was es dafür braucht, deutet Streeruwitz nur an. Ihre Ideen sind nur auf den ersten Blick aberwitzig, wenn sie vorschlägt, sich der charismatischen Persönlichkeiten zu entledigen und narzisstische Persönlichkeitsstörungen aus dem Kosmos des Öffentlichen auszuschließen: oder wenn sie fordert, langweilig ausgeglichene Personen sollten unsere Vertretung übernehmen.
Freilich ist das «Handbuch gegen den Krieg» als ein starkes Plädoyer für ein neues Miteinander, für ein ganz praktisches Konzept des Friedens, als das literarische Herantasten an eine umfassende Erlösungsformel für so ziemlich alle Misslagen dieser Welt, eine höchst utopische Schrift. Aus der Feder von Marlene Streeruwitz überzeugt der Band mit seinen minimalistischen Einwortsätzen und den einprägsamen wie präzisen bildlichen Analogien selbstredend zu allererst als literarische Schrift; als ein Text mit hoher analytischer wie emotionaler Schlagkraft.
Frieden ist ein anderes Wort für Gerechtigkeit. (Marlene Streeruwitz)
Weder wird dieses Buch Menschen in der Ukraine das Leben retten noch Politikern entscheiden helfen, ob sie nun Waffen liefern sollen oder nicht. Was Streeruwitz jedoch gelingt: Sie unternimmt den Versuch einer neuen Erzählung von Krieg und Frieden. Einer, die Frieden nicht nur als die vorübergehende Abwesenheit von kriegerischen Handlungen sieht, sondern als das aktive Durchbrechen von systematischer Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung; als ein Ausmerzen des Problems an seiner alltäglichen, individuellen Wurzel statt der verzweifelten kollektiven Symptombekämpfung auf dem Niveau von Nationen und Armeen.
Auch wenn diese neue Erzählung eines wertschätzenden, gewaltfreien wie friedlichen Miteinanders nicht nur fern sein mag, sondern vielleicht Utopie bleiben muss: Es braucht die Kraft der Kunst, die starken, wortgewaltigen Bilder der Literatur, um überhaupt eine Sprache entwickeln zu können, in der wir einander vom Frieden erzählen könnten – wenn die Zeit reif dafür sein sollte.
- Sortieren nach: Standard
- Anzeigen: 12 Produkte pro Seite