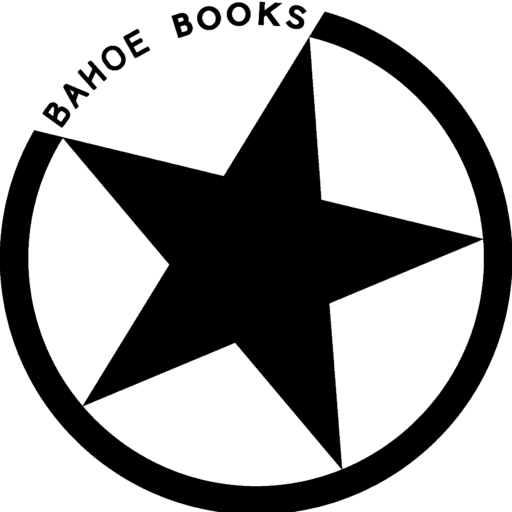„Krieg. Und. Alles ist falsch.“ Mit diesen kurzen, orthografisch eindrücklich stolpernden und gerade darum noch überzeugenderen fünf Worten eröffnet Marlene Streeruwitz ihr ebenso knappes wie starkes »Handbuch gegen den Krieg«, das in diesen Tagen auf jedes Nachtkästchen, in jedes Buchregal, in jede Bibliothek – und vor allem: gelesen – gehört. Der Text ist ein Ringen um ein Sprechen vom und für den Frieden in einer Zeit des Kriegsgetöses allerorten, und gerade darin überzeugender als so manche Expertise, die wir seit dem »Ausbruch« des Krieges in der Ukraine Ende Februar 2022 in medialem Stakkato zu hören bekommen. Dieses (Wider-)Sprechen vom und für den Frieden ist notwendiger Teil einer reflexiven und kritischen Kultur des Friedens auf Basis eines breiten Verständnisses von Gewalt, Macht und Herrschaft. Nichts erscheint in diesen Tagen weniger opportun zu sein. Nichts dringlicher.
In verdichteten Überschriften, eindringlichen Sätzen und maximal reduzierten Textfragmenten bringt die Autorin unmissverständlich auf den Punkt, woran sich Politik und Wissenschaften (einschließlich weiten Teilen der Friedens- und Konfliktforschung) eindeutig uneindeutiger abarbeiten: Krieg ist eine äußerst stabile Institution, hält Streeruwitz nicht nur mit Blick auf die Ukraine fest. Krieg ist selten eine Überraschung und niemals ein Naturereignis, sondern von Menschen gemacht, „eine sorgfältig konstruierte Maschine der Gewalt“ (S. 5). Krieg ist Bühne, bisweilen Unterhaltung und künstliche Psychose, Missbrauch in Pseudoempathie und nicht zuletzt die dominante kulturelle Gründungsgeschichte der Moderne. Krieg ist, so die Autorin weiter, die Grammatik der Mächtigen. Wer überleben will, muss diese Grammatik verstehen und erlernen, während wir weiterhin nichts über den Frieden lernen und noch weniger über ihn zu verstehen scheinen. Ganz im Gegenteil erhalten und geben wir einander, bisweilen wider Willen, Lektionen in Krieg. „Wir werden sogar durch unsere Tränen, unser Mitleid mit den Opfern in den Missbrauch“ des Kriegsgetöses und damit des Krieges selbst hineingezogen, so Streeruwitz (S. 19). Selbst unsere Bemühungen des Helfens zählen „zur Beute der Kriegsführenden“ (S. 19), und zwar auf allen Seiten. Weil wir Menschen – wenn auch in höchst unterschiedlichem Ausmaß – in der brutalen Zufallslogik des Krieges als dessen potenzielle Kollateralschäden mit einkalkuliert sind, haben wir Angst. Und Angst, so die Autorin, macht einfältig, unlogisch, unvernünftig: „Angst sucht Schutz. Biedert sich an. Angst stimmt der Gewalt zu, um der Gewalt zu entkommen.“ (S. 6)
In diesem Dilemma stecken weite Teile der derzeitigen öffentlichen Debatte, die zugleich einen strategischen Faktor im Kriegsgeschehen darstellt. Der unbedingte Ruf nach Handlung wird mit physischer, aber auch mit diskursiver, kognitiver, ja affektiver Militarisierung beantwortet, die sich bisweilen mit Friedenstauben und -zweigenrum schmückt, während pazifistische oder auch nur an einer anderen Interpretation von Frieden, gar entlang eines strukturellen, antikapitalistischen und antipatriarchalen Verständnisses von Gewalt orientierte Stimmen immer schonungsloser diskreditiert werden. Während, getragen von diesem Diskurs der Unvermeidbarkeit, Milliarden in Kriegsgerät nicht nur in Russland, sondern aus aller Welt auch in die Ukraine fließen, wird Europa allerorten blau-gelb beflaggt – real wie auch mental. In selektiver zivilisatorischer Verbundenheit mit einem vielen Europäer* innen bis heute unbekannten Staat beruft sich Europa auf seine demokratischen Grundwerte, die es zugleich im Namen einer neuen »europäischen Sicherheitsarchitektur« zu opfern bereit ist, wie die zunehmend nationalistische und militarisierte Diskursverengung zeigt.
An diese kognitiv-mental-affektive Dimension von Krieg und Gewalt erinnert das »Handbuch gegen den Krieg« ganz aus- und eindrücklich. Vehement widersetzt sich dessen Autorin der Logik des Zählens und Zahlens und der stets selektiven Operationalisierung, mit der uns Sicherheits- und Rüstungsexpert*innen ebenso wie Politiker* innen aller Couleur täglich aufs Neue in den Chor der aufgeregten Aufrüstung, der vermeintlichen Versicherheitlichung, der angeblichen Vernunft der Moral einstimmen. In Streeruwitz’ Worten: „Und alle treten auf und wissen alles. Vermutungen. Taktische Vorschläge. Wahrsagerei. Wunschvorstellungen.“ (S. 25) Vor mehr als hundert Jahren, im Angesicht des heranrollenden Getöses des Ersten Weltkrieges, schrieb Karl Kraus: „Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige!“ (Karl Kraus (1914): In dieser großen Zeit. In: Die Fackel. Herausgeber: Karl Kraus, Wien 1899- 1936, 16:404, S. 1-20.) In diese stets marginalisierte Tradition des schier unmöglich erscheinenden Versuches, gegen den Krieg anzusprechen, anzudenken, anzuschreiben, reiht sich auch Streeruwitz ein. Darüber hinaus ergänzt sie die antikapitalistische Analyse des frühen 20. Jahrhunderts konsequent um eine feministische, auch am Konzept der strukturellen und diskursiven Gewalt orientierte, Kritik des Krieges. Gerade damit erinnert sie (mich) auch an Christa Wolfs eindrückliche Figur der Kassandra, die uns lehrt: „Mitten im Krieg denkt man nur, wie er enden wird […]. Wenn viele das tun, entsteht in uns der leere Raum, in den der Krieg hineinströmt.“ Inmitten dieses Strömens scheinen Kraus, Wolf und Streeruwitz zu einem ähnlichen, von Kassandra wie folgt formulierten Fazit zu gelangen: „Lasst euch nicht von den Eigenen täuschen.“ (Christa Wolf (1983): Kassandra. Erzählung. Darmstadt: Luchterhand.)
Wieder einmal erweist sich die Literatur als vielleicht kraftvollste und überzeugendste Stimme für den Frieden, nicht nur als politische Utopie, sondern als ebenso alltägliche wie bewusst normative Denk- und Sprachhandlung, die auch heute eine wichtige Verbindung zwischen Friedensbewegung und Friedensforschung sein kann – und soll. Möge es dem schmalen Band, der interessanterweise nicht – wie Streeruwitz zahlreiche Romane – in einem großen deutschen, sondern in einem kleinen Wiener Verlag erschienen ist, gelingen, mehr Leser*innen zu bewegen als dies den zahlreichen, aber weitgehend ungehört bleibenden, kritischen Stimmen der Friedensforschung derzeit möglich ist: bewegen zum Nachdenken, zu Kritik am dominanten Diskurs der Unvermeidbarkeit, zum Widerspruch gegen Aufrüstung und „Pseudoempathie“ (S. 41) – und auch auf die Straße.
- Sortieren nach: Standard
- Anzeigen: 12 Produkte pro Seite