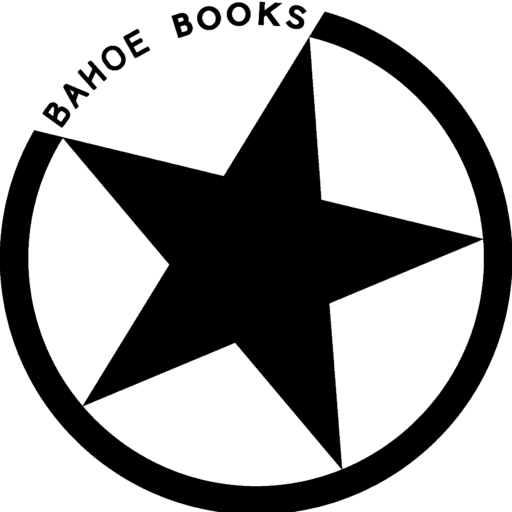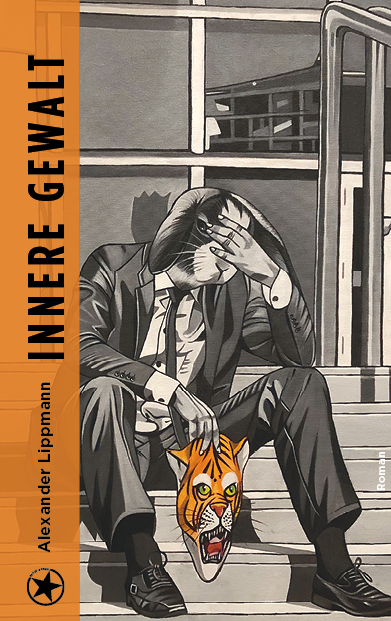In seinem Roman „Innere Gewalt“ erzählt Alexander Lippmann von den moralischen Verwüstungen der zynischen Gegenwart.
Olivia Wolf, Mitte 30, seit ein paar Jahren in einer kinder- und auch ein wenig trostlosen Beziehung, arbeitet als leitende Angestellte in einer Agentur für politische PR, beziehungsweise, wie es ihr Chef Wolfgang beschreibt: „PR, Social Media, Medienbeobachtung oder einfach ein Raum, wo Ideen wachsen können, ein Inkubator.“
Vor 100 Jahren hätte man diese Arbeit entfremdet genannt, heute vielleicht: perspektivenarm. Ultrazynische Projekte bahnen sich an, die Arbeitslose und Geflüchtete bei ihrem Sozialkapital packen sollen (sind Kummer und Flexibilität gewohnt!). Bei dieser Anbahnung tun sich freilich Hindernisse auf, von denen nicht ganz klar ist, ob sie paranoiden Ursprungs sind oder doch Effekte einer realen Verschwörung. Das Projekt driftet so oder so in den Wahnsinn: Begegnungen und Bildschirme kippen in schauerromantische Effekte, der Firnis des Alltags bekommt Risse, als wäre E.T.A. Hoffmann plötzlich auf LinkedIn.
Aber die gruseligsten Passagen von „Innere Gewalt“ bleiben die schauerlich normalen: Autor Alexander Lippmann, 1978 in St. Pölten geboren, versteht sich in der lakonischen Beschreibung dessen, was niemand wahrnehmen mag. Das unterdrückte Bewusstsein der modernen Arbeitnehmerin kehrt als anschwellender Alptraum zurück: „Olivia telefoniert und schreibt E-Mails. Ab und zu hat sie eine Besprechung, bei der sie über Nachrichten oder Telefonate redet und die damit endet, dass sie Menschen anrufen muss, weil sie nicht reagiert haben.“ Dieser Roman stellt eine bedrückende Frage: Was, wenn diese Arbeit wirklich nichts als eine psychologische Schießbude ist, in der es nur Trostpreise zu gewinnen gibt – und sehr viel zu verlieren, vor allem natürlich: sich selbst?
- Sortieren nach: Standard
- Anzeigen: 12 Produkte pro Seite